Im Gespräch mit Jörg Sperling, dem scheidenden Kustos Malerei, Grafik, Skulptur im BLMK Cottbus
Jörg Sperling (Jahrgang 1953, in Weimar geboren) gehört seit fast 33 Jahren zu den Cottbuser Kunstsammlungen, die sich seit geraumer Zeit als Brandenburgisches Landesmuseum für moderne Kunst (BLMK) über die Grenzen der Lausitz und des Landes Brandenburg einen Namen machen. Er ist Kustos (Sammlungsverantwortlicher) für Malerei, Grafik, Skulptur. Manches, was sich in Cottbus entwickelt hat, trägt seine Handschrift. Im Sommer scheidet er aus dem Team der Kulturstätte, die seit 2014 unter der Leitung von Ulrike Kremeier steht, aus und tritt in den Ruhestand. Für unser Gespräch hat er vier Kunstwerke aus dem Besitz des Museums ausgesucht.
Herr Sperling, nach welchen Kriterien haben Sie diese kleine Auswahl getroffen? Ihre Lieblingsbilder? Die bemerkenswertesten aus der Sammlung, oder?
Ja, bemerkenswert sind schon alle vier, und alle haben ihre Geschichte und Geschichten, die sich mit Geschichte und Geschichten dieses Museums und mit meinen eigenen verbinden. Außer dem eigenen Geschmack und der eigenen Erfahrung misst sich das auch und vor allem an unserem Profil. Wir kümmern uns um Gegenwartskunst, wir kümmern uns um Brandenburg, um Kunst aus der DDR und Ost-Deutschlands. Andere Maßstäbe gibt es nicht. Natürlich trägt auch jedes dieser Kunstwerke etwas von einem Lieblingsstück in sich.
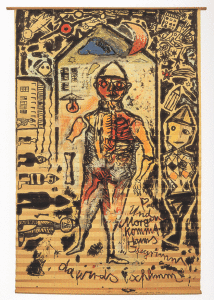
Andreas Küchler: Und Morgen kommt Hanns Isegrimm da wird`s schlimm, 1985
Mischtechnik auf Faltpapierrollo, Foto: Archiv BLMK, © VG Bild-Kunst Bonn 2019
Und Andreas Küchlers „Und Morgen kommt Hans Isegrimm da wirds schlimm” gehört dazu?
Unbedingt. Das ist ein Faltpapierrollo ganz schlichter Natur, von Andreas Küchler bemalt für ein besonderes Kunstereignis 1985 in Coswig. Als ich 1988 meine erste Ausstellung in Cottbus gestaltete, gehörte er zu den etwa 30 beteiligten jungen DDR-Künstlern. In der Ausstellung mit dem Titel „Figur = Zeichen” ging es um junge neoexpressive Kunst, das ist figürliche Malerei mit einer besonders intensiven Farbigkeit. Andreas Küchler, mein Jahrgang, aber leider schon 2001 verstorben, ist ein wichtiger Vertreter dieser Stilrichtung.
Was ist das Besondere an diesem Rollo?
Ich sehe es als ein symptomatisches Werk, gleichwohl es auf vergänglichem Material gemalt wurde. Es ist ja keine Leinwand und kein Holz, sondern dieses spröde DDR-Papier, wo wir gerade drum kämpfen, dass dieses und ähnliche Werke restauriert und konserviert werden, um sie für die nächste Generation zu erhalten. Küchler, dessen Arbeiten ich sehr schätzte, hat mit seinem Selbstporträt in Pierrotgestalt Welt- und Eigenbedrängnis formuliert. Das war damals, in den Achtzigerjahren, auffällig: Junge Kunst war oftmals auch „andere“ Kunst. Im Besitz des BLMK sind heute etwa 30 Faltrollos. Wir wollen sie neben Künstlerbüchern und Künstlerplakaten ab 18. Mai in der Ausstellung „Papier ist (un)geduldig” zeigen, die sich mit Kunst quer zu politischen Maßgaben der DDR-Kulturpolitik befasst.
Junge Kunst lag Ihnen wohl schon immer am Herzen?
In Weimar geboren und aufgewachsen, erlebte ich 1969, als das Bauhaus 50 wurde, so etwas wie einen Befreiungsschlag gegen den Klassikerkult. Eine Zeitlang danach wollte ich Architekt werden. Noch als Oberschüler schlichen wir uns in den Studentenklub, wo es richtig spannend und unter der Hand manchmal subversiv zuging. Die Armee rief mich dann nach Berlin. So nervtötend der „Ehrendienst” war, so reizvoll war das Kulturleben in der Metropole. Mittlerweile hatte ich Interesse an einem Kunstwissenschaftsstudium gewonnen, bekam aber keinen Platz. Stattdessen winkte das Winkelmann-Museum in Stendal, dessen Chef festen Fuß in der Kunstszene hatte. Da sammelte ich ebenso wertvolle Erfahrungen wie im Museumsalltag selbst, wo ich alle Arbeiten, die so anfallen, durchlaufen durfte. Das Studium, das sich dann doch verwirklichte, eröffnete neue Welten. Das Berufspraktikum verschlug mich nach Dresden, wo ich eine für mich überraschende vielseitige Kunstlandschaft vorfand. Und immer wieder junge Kunst. Ich nutzte die Gelegenheit, Künstler in ihren Ateliers aufzusuchen. Nach einer Zeitlang als freischaffender Kunstwissenschaftler kam der Ruf nach Cottbus mit dem schon beschriebenen Startschuss. Ja, und auch das nächste Bild ist damals junger Kunst zuzuordnen.
Clemens Gröszer „Café Liolet”. Glaubt man gar nicht, dass das in der DDR entstanden ist.
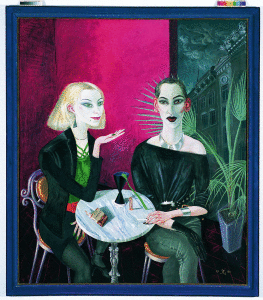
Clemens Gröszer: Café Liolet, 1986
Mischtechnik, Collage auf Leinwand, Foto: Bernd Kuhnert, Berlin, © VG Bild-Kunst Bonn 2019
Gut beobachtet. In der Tat knüpft der Künstler an große Vorbilder aus der Malerei der 20er Jahre des vorigen Jahrhunderts, zum Beispiel Otto Dix, aber auch aus der Renaissance, hier vor allem Lucas Cranach d.Ä., an. Es war ein Glücksfall, dass dieses Bild zu uns kam. Es entstand in einem deutsch-sowjetischen Projekt während der Zeit von Perestroika und Glasnost und wurde uns angeboten. Wir haben erfreut zugegriffen. Die erste große Personalausstellung hat Gröszer bei uns in den 90er Jahren bekommen, und die wanderte u.a. auch nach Halle und Rostock. Heute ist es so, dass viele Werke von Gröszer in Cottbuser, keines aber etwa in Besitz der Berlinischen Galerie ist. Berlin war doch sein Lebensmittelpunkt. Allerdings findet glücklicherweise gegenwärtig eine Ausstellung in der Zitadelle Spandau statt, wo von uns zwei Leihgaben dabei sind.
Sie haben Künstler und ihr Lebenswerk fortlaufend im Blick.
Das ist immer wieder eine spannende Auseinandersetzung mit Entwicklungsprozessen der modernen Kunst: Was ist ein wichtiges Kunstwerk, was eine wichtige Strömung? Wer sind die Künstler, die gegenwärtig wichtige und intensive Werke schaffen, nicht selten weitab von aktuellen Strömungen? Nur so werden wir, glaube ich, unserem Profil gerecht. Unser Augenmerk liegt eben auf ostdeutscher Kunst und aus unserer Region heraus ist es immer spannend Trends zu beobachten.
Auf die Region kommen wir später. Ich habe gesehen, in Ihrer Auswahl ist ein bedeutender Vertreter von hier. Aber zunächst zu einem ganz besonderen Werk. Ginge es um Literatur, würde ich sagen: Das ist ein Thriller.
„Das Blutbuch” von Micha Brendel. Ein außergewöhnliches Objekt: Ein Tagebuch mit dem eigenen Blut geschrieben. Es ist in unseren Besitz gekommen, als wir nach der Wende eine Ausstellung von Künstlerbüchern veranstalteten. Selbstverlegte Künstlerbücher waren wie originalgrafische Zeitschriften beliebte „Untergrund“-Publikationen. Oft wählte, wer mit den Funktionären quer lag, diese Form der Veröffentlichung. Brendel lag quer, stellte einen Ausreiseantrag und durfte im Herbst 1989 in den Westen ausreisen. Als er dort ankam, fiel hinter ihm die Mauer. Frust und Depressionen waren die Folge. Er hatte sich mit alten Kulturen, auch magischen Ritualen befasst und war auf die Form des Aderlasses gestoßen. Regelmäßig zapfte er bei sich Blut, stieß damit einen Selbstheilungsprozess an und führte Tagebuch. Als er dieses nach fast genau zwei Jahren zuschlug, war er längst wieder in der Welt.

Micha Brendel: Blutbuch, 1990-1992
Blut auf Papier, Ganzleinen, Fadenbindung, Stahl, Glas, Plasikhandschuhe (genäht), Lampe, 320 Seiten, Foto: Andreas Rost, Berlin, © VG Bild-Kunst Bonn 2019
Das Foto weckt den Eindruck, dass das Buch nicht frei zugänglich ist?
Brendel hat es in einem Inkubator untergebracht, um kontrollierte Außenbedingungen zu schaffen. Das ist ein Zeichen für Sorgsamkeit und Vorsicht, symptomatisch für psychische Prozesse, die sich mit der Entstehung und dem Inhalt des Buches abspielen. Ein extremes Werk.
Ein extrem aufregendes Werk.
Das stimmt. Es führt ja in Dinge, die in unserem Inneren geschehen, in den seelischen Bereich. Das wird oft lächerlich gemacht und als Humbug abgetan: Das sei ja nur Esoterik. Nein, hier werden Entdeckungsreisen in die innere Welt unternommen.
War Günther Friedrich für Sie auch eine Entdeckung?
Ich habe vor etwa 15 Jahren, einer Idee von Hans Scheuerecker und Frank Merker folgend, die Ausstellung „Günther Friedrich und Freunde” gemacht. Neben denen von Scheuerecker und Merker waren auch Bilder von Gerhard Knabe und Dieter Zimmermann zu sehen. Von Scheuerecker erfuhr ich, was für ein Mensch Friedrich war, sorgsam und voller Verständnis und Aufmerksamkeit für andere Künstler. Er hat Scheuerecker darin bestärkt, seinen Weg zu gehen. In der Arbeit an dieser Ausstellung habe ich Günther Friedrichs Werk schätzen gelernt. Er ist leider in der DDR-Kunstgeschichte völlig unterbelichtet geblieben. Wir sind jetzt, nachdem Witwe und Tochter uns das ermöglicht haben, dabei, seinen Nachlass zu übernehmen. Früher schon waren wir auf eine Wunschliste von ihm gestoßen, auf der er jene Bilder aufgeführt hat, die er gern ausstellen wollte. Dies haben wir dann 2015 mit Katalog realisiert.
Das, was Sie für dieses Interview herausgesucht haben, war gewiss dabei?
Das ist ein Bild mit einer spannenden Komposition. Mit fragendem, ernstem Blick schaut der Künstler aus dem Bild. Hinter ihm bemerkt man zwei Drittel Leere neben einem Neubaublock. Es herrscht Tristesse. Es ist fern allem von der Obrigkeit gewünschten Pathos. Er hatte damals wohl Ärger gehabt mit den Verantwortlichen des Chemiefaserkombinates Guben, wo er einen Zirkel leitete, und war ausgestiegen. Es scheint so, als spräche aus diesem Bild die Kälte des Abschieds. Als unsere Direktorin Ulrike Kremeier, die sehr interessiert an der ostdeutschen Kunst und ihrer Präsentation ist, eine Ausstellung zur Porträtfotografie vorbereitete, suchten wir für eine entsprechende Sammlungspräsentation Bilder und stießen auf dieses Gemälde. Es entspann sich ein spannendes Gespräch und unsere unterschiedliche Sicht aus West und Ost öffnete die Augen.
Die Cottbuser Kunsthistorikerin Susanne Lambrecht hat ja Günther Friedrich mit einem Buch, das wohl leider vergriffen, wohl aber in der Stadt- und Regionalbibliothek noch erhältlich ist, ein Denkmal gesetzt.
Das Buch enthält ein Werkverzeichnis und eine Analyse unter kunsthistorischen und vor allem kunstpolitischen Gesichtspunkten. So viel steht fest, es ist im Nachlass dieses Künstlers noch so manche Entdeckung zu machen. Ich würde künftighin gern an dieser Expedition in sein Lebenswerk mitwirken wollen.
Wir haben über vier Kunstwerke gesprochen. Wie viele haben Sie als Kustos in der Verantwortung?
Etwa 42.000 Werke beherbergt das BLMK insgesamt. Das teilt sich auf in Fotografien, Gemälde, Arbeiten auf Papier, Künstlerbücher, Plastiken, Objekte und Plakate. Für meinen Verantwortungsbereich liegen die Zahl etwa bei 5.000 Werken.
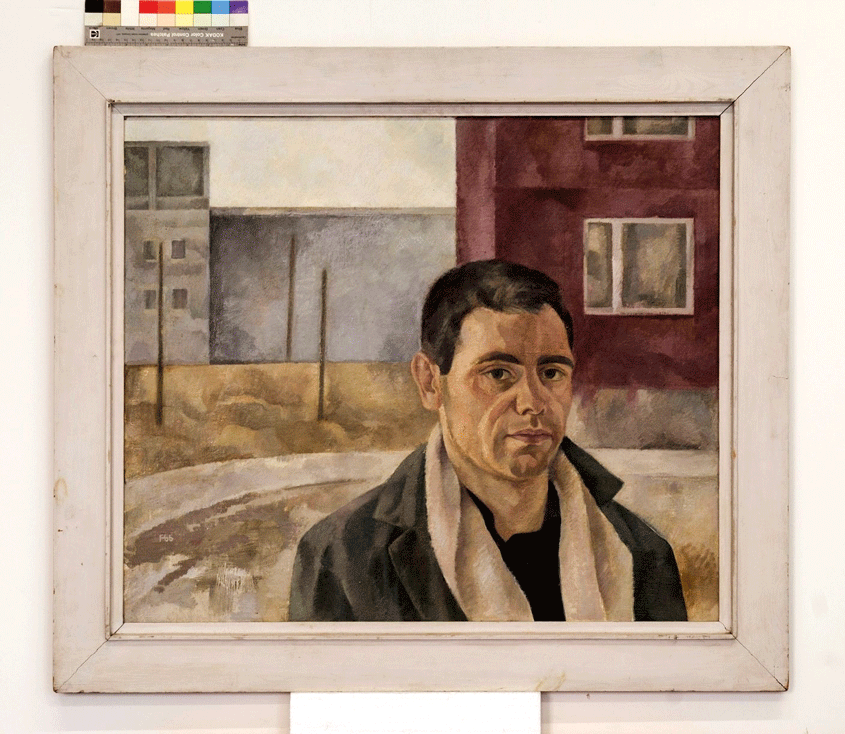
Günther Friedrich: Selbstporträt 1966 (Am Kaltenborner Eck), 1966
Öl auf Hartfaser, Foto: Andreas Kämper, Berlin
Ist, in einem Museum zu arbeiten, nicht eine unwahrscheinlich schöne Arbeit?
Das habe ich schon oft gehört, und das sagen viele. Sie haben einerseits recht. Sehr recht. Sie übersehen aber, dass da auch eine Kehrseite ist. Museumsarbeit hat sehr viel mit Planung und Organisation zu tun. Ausstellungen mögen schön anzusehen sein, aber je mehr sie auf- und anregend wirken, desto mehr Vorarbeiten stecken in ihnen. Man will den Besuchern ja auch Material in die Hand geben, das die Eindrücke vom Sehen vertieft, einen fundierten gut gestalteten Katalog zum Beispiel. Mir war es auch immer wichtig, dass sich Künstler selbst über ihre Arbeit äußern, in Gesprächen etwa zur Finissage und/oder im Katalog. Und neue Kunstwerke brauchen ganz besonders eine Wegbegleitung durch das Wort.
Wie kommen Sie denn eigentlich zu neuen Ausstellungsstücken?
Es gibt ja finanzielle Mittel für Ankäufe, die aber doch wie fast überall beschränkt sind. Da folgen wir einer alten Praxis, Werke aus den Ausstellungen zu kaufen, die wir selbst veranstaltet haben. So sind wir dabei, von Lothar Böhme und seiner Frau Christa Böhme zwei Werke zu erwerben. Es gibt erfreulicherweise auch Schenkungen. Johannes Heisig hat uns seine Grafikmappe „Die Krähe” übereignet, weil er erklärtermaßen so zufrieden mit unserer Präsentation im letzten Jahr war. Schenkungen erhielten wir z.B. auch von Michael Morgner und Manfred Butzmann. All das liegt auch daran, dass die Tore unseres Hauses für Ostkunst weit offenstehen.
Wonach richtet sich denn, ob Sie ein Kunstwerk annehmen?
Da gibt es verschiedene Kriterien. Eines davon ist, wie ist der Künstler mit unserer Sammlung und der Region verwurzelt? Wir verfolgen auch, wie bereits gesagt, Werkentwicklungen. 75 Prozent unseres Bestandes sind ja Kunst aus der DDR. Da kommt es vor, dass man sagt, es fehlt noch ein besonders „augenfälliges”, typisches, schlagkräftiges Bild aus der Hand der Künstlerin oder des Künstlers. Da beginnt dann die Suche. Von der Schriftstellerin und Malerin Gabriele Stötzer haben wir aus einer Ausstellung heraus das wichtige Künstlerbuch „Urfrauen“ erworben.
33 Jahre Cottbus in Ihrem Lebenslauf, das ist viel Zeit, Weggefährten, Mitstreiter, Freunde zu gewinnen. Wie ist da Ihre „Bilanz”?
Da denke ich doch gleich an das Haus 23. Ein großes „Hobby“ neben der Tätigkeit im Kunstmuseum. Die Galerie, die ich noch im Herbst 1989 selbst mitgegründet habe und die jetzt ihre allerletzte Ausstellung vorbereitet, erweist sich als ein Freundeskreis, der – bei allen unvermeidlichen Schwankungen – bis heute zusammengehalten hat. Bei der Erkundung von Ateliergeheimnissen sind viele Freundschaften entstanden, zum Beispiel mit Matthias Körner und Dieter Zimmermann, aber auch mit Künstlern in Dresden, Berlin und selbstredend im Land Brandenburg.
Sie bezeichnen sich gelegentlich als einen Romantiker. Wie das?
Ich liebe den Blick in die Natur. Deshalb ist Caspar David Friedrich mein Favorit unter den Malern. Wie er seine Naturstudien geradezu extensiv betrieben hat, das ist schon beeindruckend. Ich wandere viel und gern und bin froh, dass gleich „um die Ecke” der Spreewald und krass daneben die Tagebaue sind, wie auch die neuen Landschaften mit ihren heftigen Umbrüchen, wo die Natur zurückkehrt. Bewusst in der Landschaft zu sein ist ein Ritual für meine Frau und mich. Wie haben schon viel von Entdeckungen gesprochen. Ich fühle mich, wie mein Name andeutet, verbunden mit der Vogelwelt. Da habe ich in Cottbus den Eisvogel entdeckt, einen türkisfarbenen Gesellen, scheu und mit seltsamem Flug. Vor zwei Jahren ist einer von ihnen hier gegen eine Scheibe geflogen und hat sich verletzt. Ich konnte ihn nicht mehr retten. Er ist mir in den Händen gestorben. Er hatte sich vermutlich das Genick gebrochen. Ich konnte nicht anders, ich habe ihn präparieren lassen.
Wir müssen zum Ende kommen. Sie wissen ja selbst „Papier ist (un)geduldig” und die Eröffnung am Freitag, dem 17. Mai, um 19 Uhr, ist nicht mehr so weit. Der HERMANN wünscht Ihnen viel schöpferische Unruhe im Ruhestand.
Gespräch: Klaus Wilke




