Quarantäne – das ist wie „lebenslänglich”
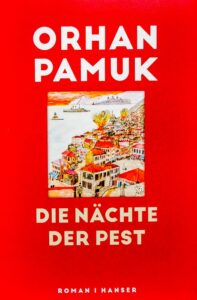
Hanser, 694 Seiten, 30 EUR
Was für ein Roman. Jeder Satz verwandelt sich in Bilder unserer Tage! Der Leser ist gebannt. Hat doch der türkische Schriftsteller Orhan Pamuk ein erstaunlich hellsichtiges Buch veröffentlicht: „Die Nächte der Pest” (Hanser, 694 Seiten, 30 EUR). Der Nobelpreisträger für Literatur 2006 erzählt von einer Epidemie auf der fiktiven Mittelmeerinsel Minger, die sich 1901 zugetragen haben soll. Er hatte es 2016 zu schreiben begonnen, als noch niemand unsre heutigen Pandemiesorgen und -probleme ahnen konnte. Was aber Leute, die sich – wie Pamuk – in der Geschichte und dem Wesen der Menschen auskennen, wissen, ist, dass die großen Krankheitskatastrophen stets einander ähnelten. Wie sich ein Teil der Mingerer den Bekämpfungsmaßnahmen demütig beugten und ein anderer Teil heftig widerwetzten, wie manche die Epidemie leugneten und sie auf Verschwörungen zurückführten, wie die Krankheit immer wieder neues Futter bekam, weil sie nicht ernst genommen wurde, das weist schon aktuelle Bezüge auf. Was bei Pamuk auffällt, ist, wie er die Pandemie in das Weltgeschehen und Weltgefüge einbaut. Der Zerfall des Osmanischen Reiches weist den tiefschürfenden Leser auf Vorgänge in den letzten 40, 50 Jahren. Das ist ein großer Geschichts-Gegenwartsroman!
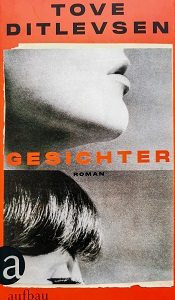
Aufbau, 160 Seiten, 20 EUR
Im vergangenen Jahr kam die autobiografische Kopenhagen-Trilogie „Kindheit”, „Jugend” und „Abhängigkeit” der dänischen Autorin Tove Ditlevsen (1917 – 1976) in den Buchhandel. Wiederentdeckt, gaben diese Romane Einblicke in den Alltag einfacher Leute, in soziale Ungerechtigkeiten, in den Werdegang einer Schriftstellerin, die sich den Anfechtungen von Süchten entgegenstellen muss. Diesen Stoffkreis nimmt auch der Roman „Gesichter” (Aufbau, 160 Seiten, 20 EUR). Es ist der Roman einer Krankheit, eines Klinikaufenthaltes, der Überwindung und Genesung. Eine Kinderbuchautorin, zwar als solche erfolgreich, aber – wiederum als solche belächelt, bespöttelt und geringgeschätzt, droht an dieser Situation zu zerbrechen. Sie sieht Gesichter, die nicht existent sind, hört Stimmen, die zu niemandem gehören, schwebt in tausend Ängsten. Tove Ditlevsen beschreibt diesen psychischen Ausnahmezustand so nah, so wahr, so plastisch, dass man sich auf Klinikbesuch wähnt.
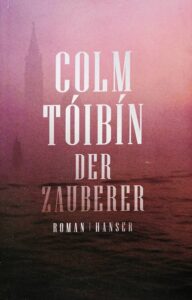
Hanser, 557 Seiten, 28 EUR
Über Thomas Mann und die Familie Mann überhaupt ist ja schon so viel geschrieben worden, dass man von einem neuen Roman regelrecht übermannt wird. Trotzdem ist der Colm Tólbíns Roman „Der Zauberer” (Hanser, 557 Seiten, 28 EUR) für all jene eine Fakten-Fundgrube, die sich Überblick über dieses Jahrhundertleben verschaffen wollen. Der irische Romanautor richtet den Fokus auf Manns Auseinandersetzung mit dem deutschen Faschismus und die Bedeutung seiner Homosexualität für seine gesellschaftlichen Bindungen und sein Romanschaffen. Eine ganze Reihe von Anekdoten geben diesem Erzählen einen lockeren Lauf. Wer mehr wissen will, halte sich an Klaus Harpprechts Biographie von 1995.

Rütten & Loening, Klappenbroschur, 493 Seiten, 16,90 EUR
Ali Hazelwood hat einen Liebesroman geschrieben, der alle Klischees tötet, wunderbar unterhält und trotzdem einen humorvoll-ernsten Blick hinter die Kulissen des akademischen Alltagsbetrieb einer amerikanischen Universität gestattet. Er belegt scheinbar „Die theoretische Unwahrscheinlichkeit von Liebe” (Rütten & Loening, Klappenbroschur, 493 Seiten, 16,90 EUR). Die junge Doktorandin Olive drückt einem Fremden unerwartet einen leidenschaftlichen Kuss auf die Lippen, gewissermaßen MeToo andersrum. Sie will ihre Freundin Anh die Skrupel nehmen, die diese als Nachfolgerin bei Olives Ex-Freund hat. Der Fremde erweist sich aber als erfolgreicher Wissenschaftler und gefürchteter Prüfungstyrann, Dr. Carlsen. Warum der an diesem Fake-Dating Gefallen findet und seinen vermeintlich besten Freund als falsch entlarvt und zwischen diesem und Olive eine echte MeToo-Affäre entsteht, das erzählt Hazelwood spannungsreich, mit überraschenden Wendungen und einigem Humor.
Klaus Wilke



